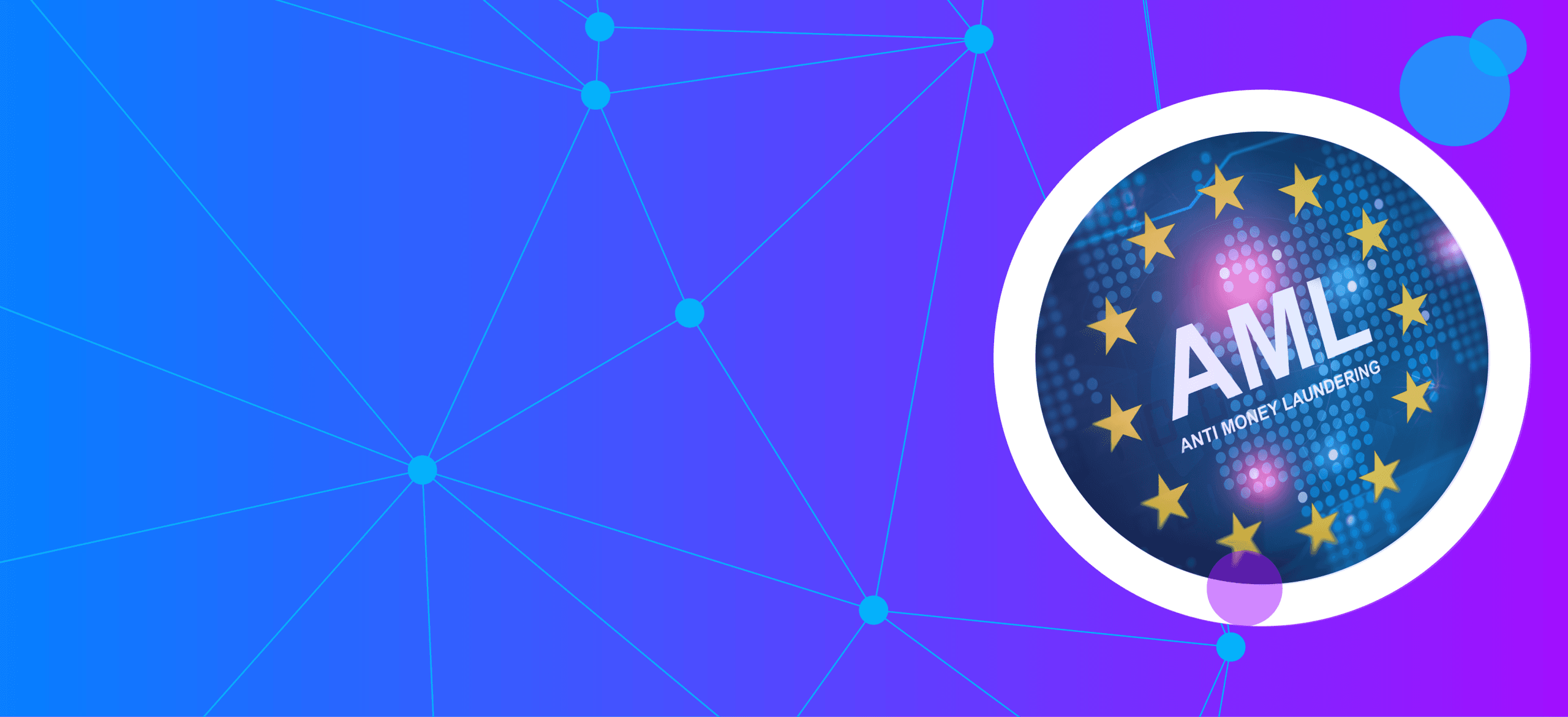The Laundromat – Ausgabe Oktober 2025
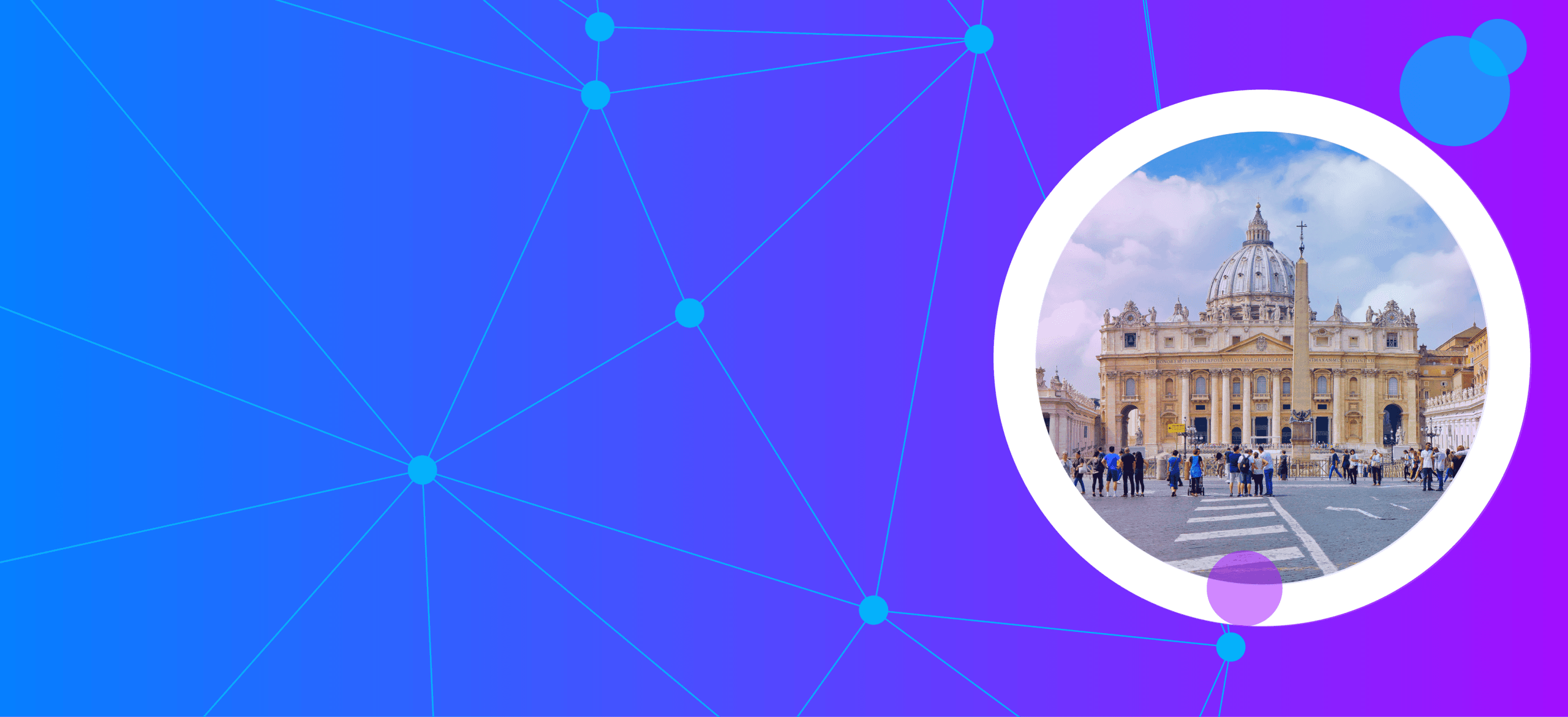
Ein Einblick in die Finanzen des VatikansEin Einblick in die Finanzen des Vatikans

Für diese Ausgabe haben wir einen umfassenderen Blick auf den Vatikan und seine Finanzen geworfen – und sind wenig überrascht, dass wir so viele Informationen gefunden haben, die durchaus einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
Ein Einblick in die Finanzen des Vatikans
Der Vatikan ist der kleinste Staat der Welt in Bezug auf Fläche und Bevölkerung, wird aber durch die Autorität über 1,2 Milliarden Katholiken mächtig – allein deshalb, weil er als Mittelpunkt der katholischen Kirche durchaus globalen Einfluss hat. Und trotz enger Bindungen an die EU bleibt der Vatikan aufgrund seiner politischen Struktur und fehlenden Marktwirtschaft zwar außerhalb der Union, übernimmt jedoch teilweise EU-Standards.
Die Finanzen des Vatikans sind seit Jahrhunderten von Intransparenz geprägt, und allein diverse Finanzskandale des Vatikans im 20. und 21. Jahrhundert sind durchaus geeignet dazu, Einblicke in fragwürdige Praktiken zu geben. Sie reichen von Allianzen im Zweiten Weltkrieg über mafiöse Geldwäsche bis zu systematischer Steuerflucht, um hier nur einige Beispiele zu nennen:
- Finanzielle Verbindungen zu den Nazis
1933 schloss der Vatikan ein Konkordat mit Deutschland, das den katholischen Widerstand gegen Hitler schwächte. Über die Vatikanbank (Institute for the Works of Religion/IOR) erhielt er regelmäßig Zahlungen in Milliardenhöhe und half dabei, Kriegsbeute unauffällig zu bewegen. Dadurch wurde das IOR zu einer Art Offshore-Bank für das Nazi-Regime. - Banco Ambrosiano (1980er Jahre)
Die Vatikanbank war Hauptaktionär der Banco Ambrosiano, die unter Roberto Calvi in großem Stil Geldwäsche betrieb. Nach ihrem Zusammenbruch 1982 mit einem Finanzdefizit von über 3 Milliarden US-Dollar musste der Vatikan 244 Millionen US-Dollar an Entschädigungen zahlen, bestritt aber eigenes Fehlverhalten. Der mit dem Vatikan verbundene Mailänder Banker Roberto Calvi (auch als „Gottes Bankier“ bekannt) soll ein Netzwerk unterstützt haben, das nicht nur die Vatikanbank, sondern auch rechte Politiker, italienische Freimaurer und US-Geheimdienste umfasste. Calvi wurde 1982 erhängt unter der Blackfriars Bridge in London gefunden. - Nunzio Scarano (2013)
Der Vatikan-Buchhalter wollte 20 Millionen Euro unversteuertes Bargeld nach Italien schmuggeln. Er wurde zwar von schweren Vorwürfen freigesprochen, aber wegen Verleumdung verurteilt. Im selben Jahr meldete die Geldwäsche-Kontrollbehörde Moneyval über 100 verdächtige Transaktionen im IOR. - Geldwäsche-Vorwürfe
Das IOR galt lange als Anlaufstelle für zweifelhafte Geldtransaktionen. Zwischen 2010 und 2012 veranlasste die Bank von Italien Untersuchungen, und selbst JP Morgan schloss ein Konto des Vatikans mit Milliardenbewegungen. - Dubiose Immobiliengeschäfte
Der Vatikan nutzte eine italienische Gesetzeslücke, die Kapellen in Immobilien steuerbefreit machte, und sparte so zwischen 2006 und 2011 rund 4 Milliarden Euro – ein Fall von Steuerhinterziehung. Der Europäische Gerichtshof erklärte dieses Nutzen der Gesetzeslücke entsprechend später für illegal, Nachforderungen könnten bis zu 13 Milliarden Euro betragen.
Der Kauf einer Luxusimmobilie in London zwischen 2014 und 2018 für insgesamt fast 350 Millionen Euro, die durch eine Reihe komplexer Transaktionen erfolgte, wurde aufgrund der öffentlichen Kritik 2022 mit 140 Millionen Euro Verlust wieder verkauft. Es hieß, der Kauf wurde zum Teil aus Peterspfennig-Spenden finanziert. Dieser Deal führte zur Korruptionsanklage gegen Kardinal Angelo Becciu, der das Geschäft beaufsichtigt hatte.
Einen umfangreicheren Einblick in die Historie der Finanzskandale des Vatikans bietet European CEO. Vielleicht auch interessant: Die Mokonomy-Dokumentation auf YouTube zum „größten Finanzskandal der letzten 30 Jahre“.
Erst unter Papst Franziskus wurde ernsthaft versucht, das Bankwesen im Vatikan zu reformieren und Transparenz einzuführen
Unter Papst Franziskus begannen Reformen und eine engere Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden. Man könnte auch meinen, Papst Franziskus hat mit seiner 2019 eingeleiteten Anti-Korruptionsoffensive regelrecht „aufgeräumt“, unter anderem mit weitreichenden personellen Konsequenzen, auch vor dem Hintergrund einer nicht allzu gesicherten Finanzsituation. Dem vatikanischen Staatssekretariat wurde die Zuständigkeit für Investitionen aberkannt, fünf vermutlich hochrangige Mitarbeitende wurden suspendiert, die Kardinalssaläre wurden mehrmals hintereinander gekürzt und der schon erwähnte Kardinal Giovanni Angelo Becciu wegen diverser Betrugs- und Veruntreuungsdelikte sogar verurteilt.
Zusätzlich führte der Papst neue Statuten für die Vatikanbank ein, zog externe Prüfer hinzu und implementierte ethische Richtlinien – räumte aber gleichzeitig die Existenz finanzieller Korruption ein.
Die von Papst Franziskus initiierten Maßnahmen zeigten Erfolg: Unter seiner Führung erhielt die Vatikanbank 2021 die höchste Bewertung vom europäischen Expertenausschuss Moneyval aufgrund der während seines Pontifikats etablierten Standards zur Vermeidung von Geldwäsche, Terrorismus-Finanzierung und anderen Formen des Finanzbetrugs.
Alles gut im Vatikan unter Papst Leo?
Papst Franziskus hat viel erreicht bei der Bekämpfung der Korruption. Sein Nachfolger, Papst Leo, steht jedoch vor der noch schwierigeren Aufgabe, die Bilanzen auf Vordermann zu bringen und das Haushaltsdefizit auszugleichen.
Neue Vorwürfe
Als wäre das nicht schon genug, wurden kürzlich neue Vorwürfe bekannt, die einmal mehr die anhaltenden Kontroversen und den hohen Reformdruck im Bereich der vatikanischen Finanzverwaltung aufzeigen.
Angeblich soll die Vatikanbank einen „Generalschlüssel für Geldwäsche“ genutzt haben, indem Banküberweisungen illegal manipuliert wurden. Der ehemalige oberste Finanzaufseher des Stadtstaates, der 2017 abgesetzt wurde, behauptet, die Gehaltsagentur des Vatikans sei in der Lage gewesen, Namen und Kontonummern in von bereits durchgeführten Transaktionen nachträglich zu ändern, wodurch Absender und Empfänger von Zahlungen verschleiert würden.
Mit diesen Manipulationen hätten Vatikan-Offizielle Gelder an Privatpersonen überweisen können, ohne deren Identität offenzulegen – was quasi unbegrenzte Möglichkeiten zur Geldwäsche böte und gegen grundlegende AML-Vorschriften verstieße.
Die Anschuldigungen stammen von Libero Milone, einem früheren Deloitte-Auditor, den Papst Franziskus 2015 zur Sanierung der Vatikan-Finanzen berufen hatte. 2017 musste er seinen Posten räumen, weil man ihm Spionage vorwarf. Er hingegen behauptet, sein forciertes Ausscheiden stehe im Zusammenhang mit der durch ihn erfolgten Aufdeckung finanzieller Verfehlungen im Umfeld des damaligen Polizeichefs und Kardinals Giovanni Angelo Becciu.
Milone berichtete kürzlich von Tools zur Bearbeitung internationaler Kontonummern (IBAN) innerhalb des SWIFT-Systems. Er wisse zwar nicht genau, wie die fraglichen Werkzeuge die bestehenden Einschränkungen umgangen hätten, aber er habe Belege dafür gesehen, dass Transaktionen nachträglich verändert wurden. SWIFT-Experten halten dies zwar technisch für unmöglich, weil Überweisungen nach ihrem Versand nicht verändert werden können, da digitale Signaturen und Verschlüsselung Manipulationen grundsätzlich verhindern sollen. Dennoch werden die Vorwürfe ernst genommen, nicht zuletzt aufgrund der hohen Glaubwürdigkeit Milones – und natürlich auch aufgrund der Vorgeschichte des Vatikans.
Geldwäschenachrichten im Überblick
CAPITAL.de: „Schweiz will Steueroase bleiben – und verwässert Geldwäsche-Regeln“
Die Schweiz wollte ihre Geldwäsche-Regeln verschärfen, stößt damit aber im Parlament auf Widerstand, denn viele Abgeordnete sehen darin die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes gefährdet. Bereits seit 2008 wurde das Land unter Druck gesetzt, ihre Regeln zu verschärfen, und galt lange als attraktiv aufgrund laxer Gesetze. Andere Länder hätten zwar strengere Gesetze „auf dem Papier“, setzten sie aber weniger konsequent um. Schweizer Politiker verweisen daher auf die Glaubwürdigkeit und Strenge ihres Vollzugs.
Hier geht’s zum vollständigen, Mitte September 2025 Artikel auf CAPITAL.de.
Leseempfehlung: Die EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie
Geldwäsche ist ein ernstzunehmendes Problem, da hierüber nicht bloß große Summen aus Drogengeschäften à la Al Capone reingewaschen und terroristische Aktivitäten finanziert werden. Sie stellt vielmehr insgesamt eine kontinuierlich wachsende Bedrohung für das Finanz- und Wirtschaftssystem dar und kann auch betroffenen Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Einbußen und Reputationsverlust zufügen.
Um diesen kriminellen Machenschaften Einhalt zu gebieten, wurde vom EU-Parlament bereits 1991 die europaweit geltende Anti-Money Laundering Directive, kurz AMLD eingeführt, die den Finanzinstitutionen und anderen betroffenen Unternehmen eine ganze Reihe an Regularien und Standards auferlegt, auf deren Basis die illegale Herkunft von Geldern zu identifizieren und zu melden ist.
Jetzt Im WebID Glossar alles Wissenswerte zur AMLD nachlesen
Verification Knowledge: Egal wann und wo
Abonniere unseren Newsletter, um regelmäßig exklusive Einblicke,Updates und Angebote rund um WebID zu erhalten.