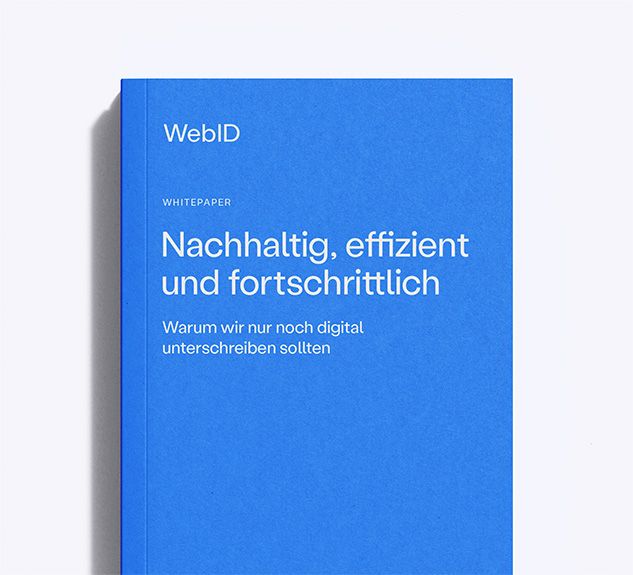BGB § 126a
Die elektronische Form nach § 126a BGB: So geht’s
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung können mittlerweile auch rechtsverbindliche Verträge durch die elektronische Form ersetzt werden. Damit können viele Geschäftsprozesse deutlich vereinfacht und beschleunigt werden – schließlich entfällt bei einer elektronischen Vertragsunterzeichnung der Aufwand des postalischen Versands zwischen den beteiligten Personen.
Dafür wurde seitens des Gesetzgebers § 126 erweitert durch § 126a Abs. 1 BGB. Dieser Zusatz formuliert ausdrücklich, dass eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) erforderlich ist.
Dieser Beitrag handelt von den möglichen Fallstricken und will Anregungen dazu geben, worauf Unternehmen bei der Implementierung einer Lösung für eine rechtsverbindliche elektronische Signatur achten sollten.
Was besagt die elektronische Form nach §126a BGB?
Ob Kredit-, Miet- Kauf- oder Arbeitsvertrag: Wenn Unternehmen mit ihren Kund:innen oder Geschäftspartner:innen rechtsverbindliche Verträge in elektronischer Form mit “wechselseitiger Schriftform” abschließen wollen, müssen diese gemäß § 126a BGB vier Voraussetzungen erfüllen:
- Es muss sich um ein elektronisches Dokument handeln, wobei hier ein analog erstelltes und anschließend eingescanntes Dokument zulässig ist.
- Der Aussteller muss seinen Namen hinzugefügt haben.
- Beide Vertragspartner:innen müssen es mit einer qualifizierten, elektronischen Unterschrift versehen haben.
- Die qualifizierte elektronische Unterschrift muss mit einer Datumsangabe ergänzt werden.
Gerade hinter den letzten beiden Punkten verbirgt sich die eigentliche Herausforderung, denn es reicht nicht, eine eingescannte und dann beispielsweise mittels Adobe Acrobat eingefügte Unterschrift in das Dokument einzufügen. Vielmehr muss hierfür ein eigens für die elektronische Form kreiertes Verifizierungssystem zum Einsatz kommen.
Welche Anforderungen stellt die "Qualifizierte Elektronische Signatur" (QES)?
Digitale Vertragsdokumente können die gesetzlich geforderte Schriftform auf Papier nur ersetzen, wenn sie gleich verschiedene gesetzliche Vorgaben erfüllen – sie also eine qualifizierte elektronische Signatur gemäß Artikel 3, Nummer 12 der eIDAS-Verordnung aufweisen, die § 126a BGB entspricht.
Darüber hinaus muss eine den rechtlichen Anforderungen entsprechende digitale Signatur von einer qualifizierten elektronischen Signatur-Erstellungseinheit (SSEE) erstellt werden und auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen, wobei der Signaturschlüssel ausschließlich in der SSEE gespeichert und verwendet werden soll.
Anbieter solcher Zertifikate können von der Bundesnetzagentur akkreditiert werden, womit auch gleich strikte Sicherheitsvorgaben an die involvierten Rechenzentren inkludiert sind. Die Akkreditierung bescheinigt, dass der Anbieter die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt und befugt ihn, qualifizierte Zertifikate auszustellen, die in Deutschlands Public-Key-Infrastruktur (PKI) durch die Root-CA der Bundesnetzagentur anerkannt sind – was dann auch durch eine anerkannte Bestätigungsstelle wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) oder eine private Zertifizierungsstelle bestätigt werden kann.
Wichtig zu wissen: Obwohl die einzelnen Komponenten einer Anwendung zur Generierung von Signaturen nicht zwingend zertifiziert sein müssen, ist eine Herstellererklärung zur Einhaltung der Vorgaben des Signaturgesetzes (SigG) und der Signaturverordnung (SigV) erforderlich.
Wie bekommt man eine digitale Signatur?
Eine den Anforderungen des § 126a BGB genügende, qualifizierte Lösung zur Erstellung digitaler Signaturen muss zusätzlich ein standardisiertes Client-Server-Protokoll zur Ausstellung von Zeitstempeln (Time Stamp Protocol oder kurz TSP) beinhalten – analoge Verträge werden schließlich auch immer mit einem Datum der Unterzeichnenden versehen.
Welche Vorteile hat § 126a BGB für das digitale Zeitalter?
Die Einführung des § 126a BGB wurden seitens der Politik die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Geschäftsprozesse geschaffen und die Einführung der Rechtsnorm bringt wichtige Vorteile für Unternehmen mit sich:
- Weniger Verwaltungsaufwand: Durch eine elektronische Signatur können Unternehmen und Behörden viel Verwaltungsaufwand einsparen. Dadurch, dass Dokumente digital unterschrieben und direkt zurückgesendet werden, fällt das Einscannen und postalische Versenden größtenteils weg.
- Kostenreduzierung: Durch die Verwendung elektronischer Signaturen können Unternehmen Druck-, Papier- und Transportkosten einsparen, die mit der physischen Unterzeichnung von Dokumenten verbunden sind.
- Nachhaltigkeit: Die Nutzung elektronischer Signaturen reduziert den Bedarf an Papier und anderen Ressourcen, was zu einer Verringerung der Umweltbelastung beitragen kann.
- Nachverfolgbarkeit: Elektronische Signaturen können mit einem Zeitstempel versehen werden, der den Zeitpunkt der Unterzeichnung genau festhält. Dies kann bei der Nachverfolgung von Vertragsabschlüssen und rechtlichen Fragen hilfreich sein.
Wann ist die elektronische Form nicht zulässig?
Gemäß § 126a Abs. 2 BGB ist die elektronische Form nach § 126a BGB unter bestimmten Umständen nicht zulässig. Dies betrifft hauptsächlich Verträge, die einer notariellen Beurkundung bedürfen. Die elektronische Form kann daher nicht für solche Verträge verwendet werden. Dazu gehören etwa Grundstückskaufverträge, Eheverträge oder Gesellschaftsverträge.
In Situationen, in denen die elektronische Form nicht zulässig ist, müssen die betroffenen Parteien also weiterhin die herkömmliche, schriftliche Form gemäß den gesetzlichen Anforderungen einhalten.
Was passiert, wenn die elektronische Form nicht eingehalten wird?
- Unwirksamkeit des Vertrags: Wenn ein Vertrag, der gemäß § 126a BGB in elektronischer Form geschlossen werden soll, nicht ordnungsgemäß unterzeichnet wird oder die Anforderungen an die elektronische Signatur nicht erfüllt werden, führt dies zur Unwirksamkeit des Vertrags. Dies bedeutet, dass der Vertrag rechtlich nicht bindend ist und die Parteien keine Ansprüche daraus ableiten können.
- Fehlende Beweiskraft: Grundsätzlich bietet die qualifizierte elektronische Signatur dieselbe Beweiskraft wie private Urkunden und ist damit ein Anscheinsbeweis dafür, dass tatsächlich die Person, deren Unterschrift unter einem Schriftstück steht, diese Erklärung auch abgegeben hat. Wird die Form des § 126a BGB nicht eingehalten oder ist die elektronische Signatur für einen Vertragstyp schlicht unzulässig, entfaltet die Signatur nicht die oben beschriebene Beweisfunktion.
Warum wir nur noch digital unterschreiben solltenWarum wir nur noch digital unterschreiben sollten
Entdecke in diesem Whitepaper, wie digitale Unterschriften dein Unternehmen revolutionieren: Sie schonen nicht nur die Umwelt und stärken dein Image, sondern sparen auch jede Menge Zeit und Kosten.
Entdecke in diesem Whitepaper, wie digitale Unterschriften dein Unternehmen revolutionieren: Sie schonen nicht nur die Umwelt und stärken dein Image, sondern sparen auch jede Menge Zeit und Kosten.